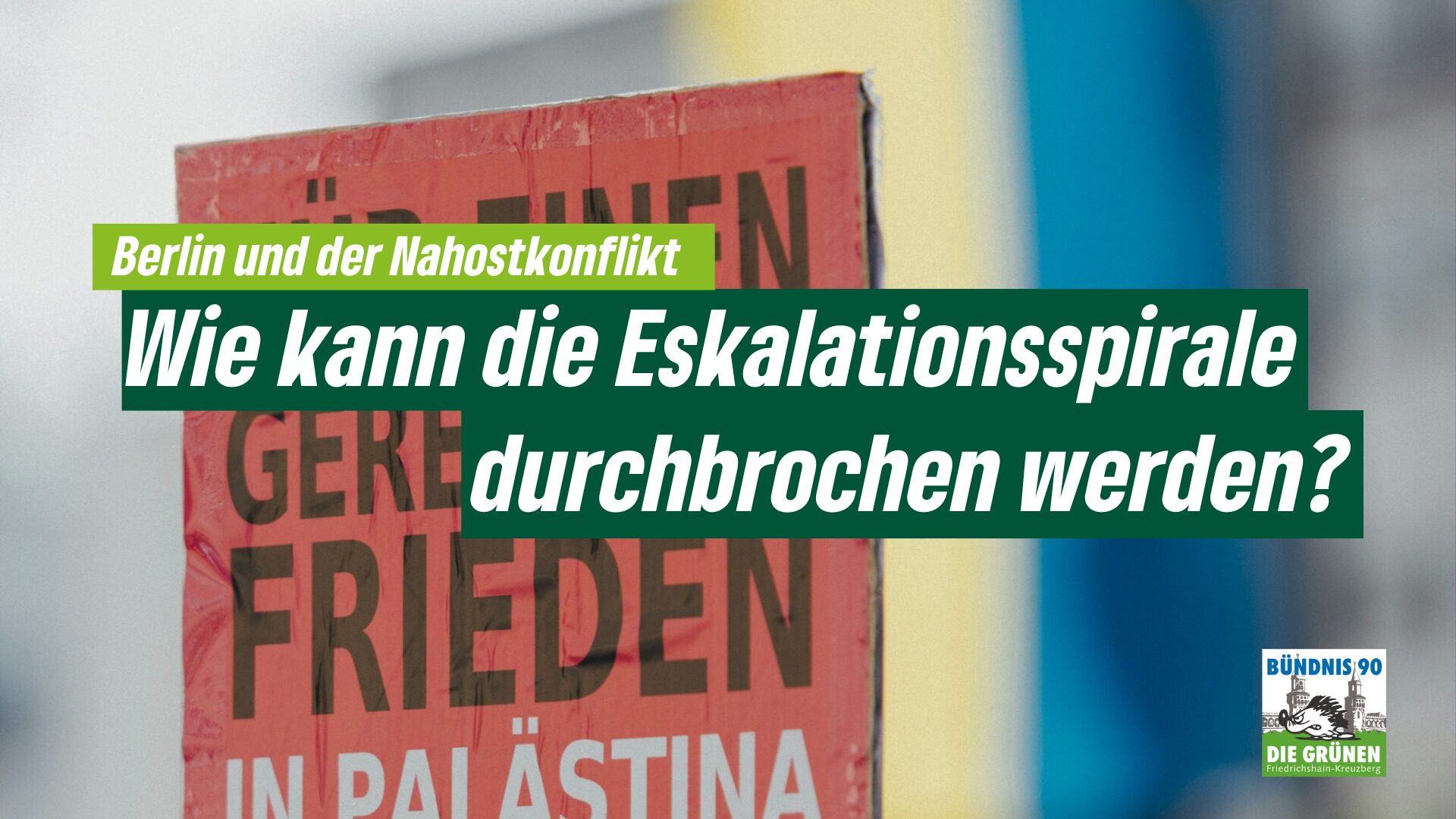Berlin, 9. Juli 2025 – Die Auswirkungen des Nahostkonflikts betreffen nicht nur eine Region im Nahen Osten – sie reichen bis in die Straßen, Klassenzimmer und politischen Räume Berlins. Unter dem Titel „Berlin und der Nahostkonflikt – wie kann die Eskalationsspirale durchbrochen werden?“ diskutierten am Montagabend im Aquarium in Kreuzberg Vertreter*innen aus Politik, Zivilgesellschaft und Communitys über die humanitäre Lage, politische Instrumentalisierung, Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus – und über das Ringen um Haltung in schwierigen Zeiten.
Israel, Gaza, Menschenrechte: Die Perspektive zivilgesellschaftlicher Akteur*innen
Zum Auftakt sprach Maja Sojref, Geschäftsführerin des New Israel Fund Deutschland, über die dramatische Situation in Israel und Gaza. Sie schilderte die humanitäre Notlage, die politischen Entwicklungen in Israel – darunter der geplante Justizumbau und drohende Gesetzesverschärfungen für NGOs – und machte deutlich: Wer Solidarität mit Israel ernst meint, muss sich auch für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und zivilgesellschaftliches Engagement einsetzen. Besonders bewegend: Beispiele zivilen Widerstands wie die jüdisch-arabische Initiative Standing Together, die in Israel für Dialog und gegen die Besatzung eintritt.
Ergänzt wurden Majas Schilderungen durch Samira Tanana, Bezirksverordnete aus Neukölln.
Berlin im Fokus: Repression, Polarisierung und eskalierende Debatten
Vasili Franco, Mitglied des Abgeordnetenhauses und innenpolitischer Sprecher, schlug den inhaltlichen Bogen nach Berlin. Er zeigte anhand von Daten zur Zunahme antisemitischer Vorfälle und Straftaten, wie sich Konflikte zuspitzen – aber auch, wie antimuslimischer Rassismus kaum systematisch erfasst wird und in der politischen Debatte häufig ignoriert bleibt. Kritik übte er an der Berliner Landesregierung: Statt Räume für Dialog zu schaffen, würden symbolische Härte und pauschale Verbote dominieren – zulasten zivilgesellschaftlicher Initiativen.
Zivilgesellschaft unter Druck: Kürzungen, Diffamierungen, Polarisierung
Susanna Kahlefeld, religionspolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus, beleuchtete den Umgang mit Projekten, die sich für Verständigung einsetzen – insbesondere im schulischen Bereich. Fördermittelkürzungen, politische Einflussnahme und Diffamierung zivilgesellschaftlicher Träger seien Teil einer Strategie der CDU-geführten Senatsverwaltung, um progressive Akteure zurückzudrängen. Betroffen seien vor allem Projekte mit muslimischer Beteiligung – selbst dort, wo bereits aktiv an Verständigung gearbeitet werde.
Debattenkultur in der Krise: Überforderung, Vereinfachung, Rückzug
Daniel Eliasson, Bezirksverordneter in Steglitz-Zehlendorf, analysierte die Auswirkungen auf den öffentlichen Diskurs und die jüdischen Communitys in Berlin. In vielen Bereichen, so Eliasson, sei eine sachliche Auseinandersetzung kaum noch möglich. Begriffe wie „Antisemitismus“ würden von allen Seiten politisch instrumentalisiert, komplexe Realitäten vereinfacht, differenzierte Stimmen zunehmend zum Schweigen gebracht. Der Ruf nach mehr Dialog, Haltung und Respekt prägte seine Botschaft: Menschenwürde und Menschenrechte müssten wieder zum Ausgangspunkt grüner Politik gemacht werden – im Inland wie international.
In Kleingruppen weiterdenken: Humanitäre Hilfe, Sicherheit, Sprache, Zivilgesellschaft
In vier Kleingruppen wurden die Themen anschließend vertieft. Es ging um:
- die humanitäre Krise in Gaza und die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure in Israel,
- die Sicherheitslage bei Versammlungen in Berlin,
- die Diskursverschiebung in der deutschen Gesellschaft, insbesondere im Umgang mit jüdischen Perspektiven,
- und den Angriff auf zivilgesellschaftliche Strukturen und Bildungsarbeit durch politische Entscheidungsträger.
Die Diskussionen zeigten: Die Herausforderungen sind groß – aber das Bedürfnis nach Austausch, differenziertem Denken und solidarischem Handeln ist in der Partei wie in der Stadtgesellschaft weiterhin vorhanden.
Ausblick: Gemeinsam Verantwortung übernehmen – auch lokal
Zum Abschluss wurde die Idee eingebracht, bestehende Beschlusslagen zur Förderung von Dialog und Zusammenhalt zu aktualisieren – etwa orientiert am Beschluss zum friedlichen Zusammenleben unseres Nachbar-Kreisverbands aus Neukölln. Die Veranstaltungsteilnehmenden signalisierten Bereitschaft, den Austausch mit anderen Kreisverbänden zu suchen, um konkrete politische Schritte daraus abzuleiten. Ziel ist es, Dialogräume zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen – und als Grüne Partei eine klare, solidarische und menschenrechtsbasierte Haltung einzunehmen.